
Lesung vom 20. Juli, 14 Uhr im Rahmen der HAV Veranstaltung Blätterrauschen.
Gino Leineweber las Auszüge aus Kapitel 7 der Teilbiografie.
Hemingway – wie alles begann,
Kindheit und Jugend in Michigan
Michigan war der Ort der Erholung vom Krieg und gescheiterter Beziehung. Unter der Trennung von Agnes hatte Hemingway außerordentlich gelitten. Seine erste große Liebe. Seine erste große Enttäuschung. Womöglich der Grund dafür, dass Hemingway später versuchte, weiteren Zurückweisungen dadurch aus dem Weg zu gehen, indem er selbst es war, der Beziehungen beendete. Das allerdings erst, jedenfalls trifft es für seine Ehefrauen zu, wenn er eine neue Liebe gefunden hatte. 1919, in Horton Bay und später in Petoskey, tröstete er sich mit Marjorie. Zunächst zog er in das Haus der Dilworths, zu Liz und Jim, dem Schmied, wo er später seine Hochzeit mit Hadley feiern würde.
Der erste veröffentlichte Roman
Im Winter 1919/1920 zog er nach Petoskey in eine Pension, das Potter’s Rooming House, 602 State Street, und schrieb weiter an seinen Geschichten. Sein Aufenthalt in dieser Stadt ist aus einem besonderen Grund erwähnenswert, denn Hemingway nutzte den Ort 1925 als Schauplatz seines ersten veröffentlichten Romans Die Springfluten des Frühlings (The Torrents of Spring).
Der Roman ist grotesk, sowohl vom Inhalt als auch von der Form. Es ist das ungewöhnlichste Buch Hemingways und entspricht einer Parodie auf Sherwood Andersons 1925 erschienen Bestseller Dark Laughter. Das Besondere an dem Buch ist allerdings nicht nur sein literarischer Gehalt, den ich ausgesprochen schätze, sondern noch etwas anderes: Es stellt den Beginn der lebenslangen Zusammenarbeit zwischen Hemingway und dem Verlagshaus Charles Scribner’s Sons dar. Hemingway hatte das Buch ursprünglich Boni and Liveright, seinem ersten amerikanischen Verlag, angeboten. Da der jedoch auch die Bücher von Sherwood Anderson herausgegeben hat, wurde die Veröffentlichung abgelehnt.
Es wird vermutet, dass Hemingway das Buch nur aus dem Grund geschrieben hat, um aus seiner Verpflichtung mit Boni and Liveright herauszukommen. Seine Frau Hadley erinnert sich: „Hemingway hat mit Scott (F. Scott Fitzgerald) über Scribner gesprochen und wollte gern zu ihm. Er war aber Liveright gegenüber verpflichtet, und um aus dieser Verpflichtung herauszukommen, schrieb er The Torrents of Spring, womit er dessen Top-Autor Anderson parodierte. Ich weiß, dass Ernest es, nur um den Verleger zu wechseln, nicht wirklich wollte. Aber Pauline wollte es, und er tat es.“ Pauline, die zuvor mit dem Ehepaar Ernest und Hadley befreundet war, wurde Hemingways zweite Ehefrau.
Die kleine Ortschaft Petoskey
In Petoskey erinnert viel an Hemingway. Nicht nur das in einer alten Bahnstation seit den 1970er-Jahren befindliche Little Traverse History Museum, in dem es drei Sektionen gibt, von denen eine Hemingway und seiner Zeit in Michigan gewidmet ist. In dem Ort kann ich mir Hemingway gut vorstellen, wie er Potters Haus an der State Street verlässt und zur öffentlichen Bibliothek geht, wo er die Zeitungen und Magazine liest, die in Die Springfluten des Frühlings erwähnt sind. Oder wie er zum Bahnhof gehen würde, um auf dem Fahrplan nachzuschauen, was die besten Abfahrtszeiten für zukünftige Angelausflüge wären oder sich die Chicago Tribune zu kaufen. Ich kann ihn mir vorstellen, wie er im Braun’s Diner sein Mittagessen einnimmt oder von der Bear River Bridge in den Fluss schaut, wie es jeder heute noch machen kann und auch ich es getan habe.
Aber wie wirkte er damals auf die Menschen, die in dieser kleinen Ortschaft lebten? Ein junger Mann, der seine Zeit mit Schreiben verbrachte und mehr trank, als es üblich war? Der kein Geld hatte, sich beim Friseur herumtrieb und dort Geschichten erzählte? Auf Schulmädchen wartete, um sie nach Hause zu begleiten und bei zwei von ihnen – Grace Quinlan und Marjorie Bump – die Abende in der Küche verbrachte. Dort Popcorn aß und auch seine Geschichten zum Besten gab? Was mögen die Bewohner, die sich daran erinnerten, später gedacht haben? Später, als er weltberühmt war? Ich weiß es nicht.
Aller Anfang ist schwer
Während seines Aufenthaltes in Petoskey gab er nicht das Bild eines Mannes ab, der eine besondere Begabung zum Schreiben besaß. Eher das eines Mannes, der nach seiner Identität suchte, sich seiner Lebensaufgabe unsicher war, und der schon zu viel erlebt hatte, um noch unschuldig-liebenswert zu sein. Wenn er überhaupt Beachtung gefunden haben mag, damals, dann kaum für sein Talent.
Er selbst berichtete später über seine Zeit dort, als er den Umfang seiner Vorbereitungen beschrieb, dass er den ganzen Herbst und den halben Winter in Petoskey arbeitete und schrieb und nichts verkaufen konnte. Es war eine Zeit entmutigender Zurückweisungen, und tatsächlich wurde seine erste Publikation, das kleine Büchlein, Three Stories and Ten Poems, im Jahre 1923 von ihm teilweise selbst finanziert. Es erschien in einer Auflage von 300 Stück. Noch weniger, nämlich 174 Stück, wurden im darauffolgenden Jahr, 1924, vom Kurzgeschichtenband in our time gedruckt. Es war ein weiter Weg bis zum Nobelpreis, den er 1954 für Der alte Mann und das Meer (The Old Man and the Sea) bekam. Oder zum zwanzig Jahre zuvor erschienenen Buch Wem die Stunde schlägt (For Whom the Bell Tolls), einem Roman über Menschen im spanischen Bürgerkrieg, der in einer Startauflage von 75.000 Stück veröffentlicht wurde und bereits ein paar Tage später ausverkauft war. Die New York Times betrachtete es damals als Hemingways „bestes, tiefgründigstes und wahrhaftigstes Buch”.
Über die Entstehung des Buches hatte Martha Gellhorn, seine dritte Ehefrau, einmal gesagt, es sei alles erfunden und trotzdem scheint es wahrhaftiger zu sein, als das Leben selbst.
Man muss erzählen können
Dass alles erfunden wäre, ist nicht ganz richtig, denn Hemingway sagt selbst, ein Schriftsteller kann nur darüber gut schreiben, was auf seinen Erfahrungen beruht. Er kannte den Krieg aus eigener Anschauung, wurde im Ersten Weltkrieg schwer verletzt, und den Bürgerkrieg in Spanien hat er als Kriegsberichterstatter erlebt. Was Martha meint, ist die Handlung. Hier zeigt sich, dass es nicht reicht, viel zu erleben, man muss Fantasie haben und Geschichten daraus machen können, man muss, wie Hemingway es von frühester Kindheit tat, erzählen können. Gerade auch das, was man erfunden hat, und Hemingway ist dafür bekannt, viel fantasiert zu haben. Nicht nur in seinen Texten.
Wie sehr Martha Gellhorn Hemingway damals bei dem Buch geholfen und es bewundert hat, geht noch aus einem anderen Brief von ihr hervor: „Inzwischen ist Scroobys Buch fast fertig. Richtig fertig ist es erst, wenn Scribner, der Verleger, es in Händen hat und zu drucken beginnt. Wir haben ungefähr 200.000 Worte korrekturgelesen, was für niemanden ein Spaß war.
Aber es ist sehr, sehr gut. Was für ein Buch! Es ist lebendig, spannend, wahrhaftig. Es handelt vom Leben und wie man lebt und vom Sterben und wie man stirbt, was schließlich alles ist, worüber man schreiben kann. Ich bin stolz auf das Buch, genau wie Scrooby und vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen erholen.“
Leben und Sterben
Diese Themen, das Leben und das Sterben, finden sich bereits in Hemingways allerersten überlieferten Geschichten, lange vor seinen Kriegserlebnissen noch zu Collegezeiten, beeinflusst durch die Natur Michigans und die Erzählungen vom Leben dort.
Das Leben in Chicago spiegelt sich dagegen in Hemingways Geschichten selten wider. Im Roman Wem die Stunde schlägt gibt es allerdings eine Passage, die auf ein Erlebnis zurückgeht, das Ernest hatte, als er 17-jährig von seinem Vater zum Bahnhof gebracht wurde, um nach Kansas zu fahren.
Der Protagonist Robert Jordan hatte sich lange nicht mehr so unsicher gefühlt wie zu dem Zeitpunkt, als er den Zug am Red Lodge zur Schule nach Billings besteigen sollte. Hemingway beschreibt die Szene wie folgt:
Er hatte Angst zu gehen, und wollte nicht, dass jemand es bemerken würde. Auf dem Bahnhof, kurz bevor er den Zug besteigen wollte, küsste sein Vater ihn zum Abschied und sagte: „Möge der Herr dich und mich beschützen, während wir getrennt voneinander sind.“ Sein Vater war ein sehr religiöser Mensch, und er meinte es einfach und aufrichtig. Aber Robert Jordan war das so etwas von peinlich, dass er plötzlich glaubte viel älter als sein Vater zu sein und er empfand ein so tiefes Mitgefühl für ihn, dass er es kaum ertragen konnte.
Ernest wird sich also nicht sonderlich wohlgefühlt haben, damals, als sein Vater ihn zum Zug nach Kansas brachte, um seinen ersten Job anzutreten.
Kansas Star
Der Kansas Star war seinerzeit eine wichtige Zeitung und galt als eine der besten im Mittleren Westen. Es war ein guter Ort für den Anfang, zumal die Zeitung die Ausbildung junger Reporter förderte.
Es war der stellvertretende Chefredakteur des Lokalteils, Pete Wellington, der maßgeblichen Einfluss auf den Schreibstil Hemingways hatte. Er war es, der ihn anleitete, in einem „kurzen, knackigen Stil“ zu schreiben. Wellingtons Regeln, die er jungen Journalisten mit auf den Weg gab, waren: „Verwenden Sie kurze Sätze. Verwenden Sie kurze erste Absätze. Verwenden Sie kräftiges Englisch. Seien Sie positiv, nicht negativ. Eliminieren Sie jedes überflüssige Wort. Spalten Sie keine Verben. Vermeiden Sie die Verwendung von Adjektiven, besonders solche extravaganten wie herrlich, wunderschön, groß, prächtig etc.“
Hemingway hat später dazu gesagt: „Das waren die besten Regeln, die ich je für das Geschäft des Schreibens gelernt habe. Kein talentierter Mensch, der es mit seinen Gefühlen und dem Schreiben ehrlich meint und die Dinge versucht, richtig auszudrücken, kann versagen, wenn er sich daran hält.“
Die Eisberg-Theorie
Hemingway hat nicht nur von ihm gelernt, sondern beispielsweise auch von Gertrude Stein. Er hat alle guten Ratschläge befolgt und war selbst ein ausgezeichneter Lehrmeister. Was er über das Schreiben gesagt und geschrieben hat, sollte jeder wissen, der auch schreiben möchte. Und ich meine nicht nur, aber natürlich auch, die „Eisberg-Theorie“. Hemingway propagiert damit eine Art des Schreibens: die Form des Auslassens. Er vergleicht es mit einem Eisberg, von dem nur ein kleiner Teil sichtbar ist. Er vertritt die Auffassung, alles könne weggelassen werden, sogar ein Schluss. Die Geschichte würde stärker dadurch. Vielleicht, aber das meine ich nicht ganz ernst, hat mich die Erzählung The Last Good Country (eigentlich ja wie erwähnt ein unvollendeter Roman) deshalb beeindruckt, weil so viel fehlt. Aber grundsätzlich halte ich viel von der Theorie, was bei mir als Poet nicht verwunderlich sein mag.
Geschichten werden stärker, wenn sie kürzer sind. Als ich Texte aus Platzgründen oder sonstigen Vorgaben reduzieren musste, hatte ich anfangs damit Probleme. Ich meinte, von meinem Text könne nichts weggelassen werden. Damit war allerdings nur meine Vorstellung verbunden, er wäre dann unverständlich. Ich glaubte, alles erklären zu müssen. Aber das muss ich nicht. Im Gegenteil. Vieles, was ich weiß, gehört nicht in den Text, sondern ist als Teil seiner Exposition für mich notwendig. Ich muss nicht die Schulzeit eines Protagonisten beschreiben. Ich muss aber wissen, wenn ich über sein Leben schreibe, welche Schulbildung er hat. Aus dem Text ergibt sich für den Leser dann eine Vorstellung darüber, was ‚in der Schule los’ war, ohne dass ich auch nur einmal beispielsweise das Wort Schule erwähne. Dies ist keine Erfindung von Hemingway, sondern für die fiktionale Erzählung ein literarisches Gebot. Was die „Eisberg-Theorie“ besonders macht, ist, dass sie das Weglassen per se propagiert. Wie ich schon andeutete, verstehe ich als Poet die Theorie problemlos.
„Ein paar Dinge, habe ich herausgefunden, sind wahr,“ sagt Hemingway. „Wenn du wichtige Dinge oder Ereignisse, die du kennst, weglässt, verstärkt das die Geschichte. Wenn du etwas weglässt oder überspringst, weil du es nicht weißt, wird die Geschichte wertlos. Der Test für jede Geschichte ist der, wie ausgezeichnet das Zeug ist, das du, nicht dein Verleger, ausgelassen hast.“
Ich habe kürzlich einen Roman gelesen, den ich als einen der besten aller Zeiten ansehe (unter meinen Top-Five). Er war von Anfang bis Ende in jeder Beziehung ausgezeichnet. Erst als ich ihn noch einmal in Gedanken durchging, fiel mir auf: Die Autorin hätte den Schluss weglassen können. Sie erklärt da noch etwas.
Das kann man machen, und es hat beim Lesen nicht gestört, weshalb der Verlag ihn auch nicht weggelassen hat. Aber ich glaube er war völlig überflüssig. Das Buch wäre ohne den Schluss noch stärker.
Einsatz für Menschen in Not
Nachdem Hemingway in Kansas zuerst bei seinem Onkel Tyler gewohnt hatte, zog er nach einem Monat zu seinem alten Freud Carl Edgar, den er von seinen Sommeraufenthalten in Michigan kannte. Der sagte über den beginnenden Reporter: „Hemingway ergab sich vollständig dem Charme und der Romantik, für eine Zeitung zu arbeiten. Er konnte stundenlang über seine Arbeit sprechen, besonders dann, wenn es besser gewesen wäre, ins Bett zu gehen.“ Hemingway lieferte kurze Texte. Er schrieb über das, was er in Kansas City gesehen hatte. Wie einmal, als er in eine Menschenmenge an der Union Station lief, die sich um einen kranken Mann versammelt, aber nichts getan hatte, um zu helfen. Er sah, dass der Mann dringend Hilfe benötigte, hob ihn hoch und trug ihn zu einem Taxi, um ihn in das Krankenhaus zu fahren.
Man sieht die Hilfsbereitschaft, die ihn auszeichnete und für die er später die Tapferkeitsmedaille bekam, weil er, selbst schwer verletzt, noch ernster verwundeten Kameraden half. Hemingway setzte sich für Menschen ein, die in Not waren. Wenn er konnte, kümmerte er sich. Seine Geschichten reichten von einem Kampf der Zeitungsboten über eine traurige Geschichte einer Prostituierten oder Schießereien zwischen Gangstern bis zu einem Artikel, in dem er die üblichen Tragödien der Notaufnahme eines Hospitals thematisierte.
Weitere Stationen
Die Tätigkeit bei der Zeitung gab er auf, weil er in den Krieg zog. Nach seiner Rückkehr versuchte er sich dann zur Missbilligung der Eltern, besonders der Mutter, in Michigan als Schriftsteller. Unverständnis der Umwelt, insbesondere der Familie, ist nicht unüblich und in Lebensläufen von Schriftstellern, auch bei berühmten, immer wieder anzutreffen. Aber Hemingway wusste selbst, dass er sich nicht nur mit Schreiben beschäftigen konnte, sondern seinen Lebensunterhalt verdienen musste.
Im Oktober 1919 war er kurz nach Chicago zurückgekehrt, hielt es dort aber nicht aus und zog wieder nach Petoskey. Er käme zu Hause nicht zum Schreiben, sagte er. In Petoskey verbrachte er die Tage neben seinen Schreibversuchen mit Aushilfsarbeiten für die Bezirksverwaltung, um Geld zu verdienen, das er nicht nur für seinen Unterhalt benötigte, sondern auch, um Marjorie auszuführen oder sich mit Freunden zum Dinner zu treffen.
Aber es reichte nicht, und er nahm dankend das Angebot an, nach Toronto zu gehen. Er bekam dort bei einer reichen Familie ein großes Zimmer mit einem Schreibtisch zum Arbeiten und musste dafür den behinderten Sohn, der nicht allein ausgehen konnte, ins Theater, zu Konzerten und Sportveranstaltungen begleiten. Durch die Vermittlung des Hausherrn bekam er einen Job beim Toronto Star, der ihn später wieder nach Europa zurückführen sollte, kurz nach seiner Hochzeit mit Hadley.
Seine Mutter war ein bisschen zufrieden über seinen „beruflichen Erfolg” und schrieb es ihm. Allerdings störte sie nach wie vor, dass ihre Erwartungen an eine Collegeausbildung sich nicht mehr erfüllen würden, die ihrer Meinung nach für einen Arztsohn aus einer Familie, in der Bildung einen Wert hatte, angemessen gewesen wäre. Erleichtert haben mag sie, dass der Sohn in der Lage war, mit Schreiben Geld zu verdienen. Aber das ging vorüber, und das gespannte Verhältnis zwischen beiden wurde nicht besser. Ernest kehrte im Mai 1920 zwar erneut nach Chicago zurück, verließ sein Elternhaus aber bald wieder Richtung Horton Bay.
Erst im Juli, an seinem 21. Geburtstag, besuchte er, begleitet von zwei Freunden, die Familie in Windemere. Er blieb einige Tage, bis die Spannungen eskalierten und er, wie erwähnt, von seiner Mutter hinausgeworfen wurde. Sie konnte es einfach nicht verstehen, dass Ernest das Schreiben zu seinem Beruf gemacht hatte und warf ihm Arbeitslosigkeit vor. Außerdem erwartete sie von ihm, dass er in Abwesenheit seines Vaters im Sommer auf Windemere dessen Stelle einnehmen sollte. Der Schriftverkehr, den seine Eltern in der Zeit hatten, zeigt, dass Grace sich ständig über ihn beschwerte. Schließlich führte ein Ereignis, das man nur als vorgeschoben bezeichnen kann, denn es war eine Lappalie, die eher Ernests Schwestern betraf, zum Rauswurf aus Windemere.
„Oben in Michigan“
Es wird berichtet, dass Hemingway in dieser Zeit sein erstes sexuelles Zusammensein mit einer Frau hatte, und dass dies in der Kurzgeschichte „Oben in Michigan“ nachzulesen wäre. Die Geschichte hat allerdings aus ganz anderen Gründen Wellen geschlagen, und bei Marcelline, der von der Mutter auserkorenen „Zwillingsschwester” von Ernest, hätte sich bei der Lektüre „fast der Magen umgedreht”.
Dies allerdings nicht, weil sie glaubte, ihr Bruder berichte von seiner ersten sexuellen Erfahrung, sondern weil er die Vornamen beliebter Freunde der Familie und auch besonders von Ernest für die beiden Hauptpersonen ausgesucht hatte: jene der beiden Dilworths, Liz und Jim – noch dazu für eine ziemlich rabiate Sexszene. Zu erinnern sei nur daran, dass Ernest, nachdem die Mutter ihm die Tür gewiesen hatte, bis Anfang Oktober ausgerechnet bei Liz und Jim wohnte.
Weshalb die Sexszene in der Geschichte mit ihm selbst verbunden wurde, liegt wohl daran, dass Hemingway den Text zuerst in der Ich-Form geschrieben, später aber die handelnden Personen ausgewechselt hat. Womöglich deswegen, weil er zum Zeitpunkt der Überarbeitung bereits verheiratet war. Die erste Fassung – die Spekulationen auslösende autobiografisch anmutende – hatte er im Sommer 1921 in Chicago kurz vor der Hochzeit geschrieben.
Dass er die Namen der Freunde verwendete, ist schwer zu begreifen. Ernest fühlte sich ihnen eng verbunden. Außer ihren Namen übernahm er teilweise auch ihr Aussehen und Auftreten. Da es die beiden – heute zumindest – nicht länger stören kann, da sie wie Hemingway nicht mehr leben, bleibt bei der Lektüre „Oben in Michigan“ für viele nur die Frage: Hat er oder hat er nicht?
Die Kurzgeschichte „Oben in Michigan“ ist nicht in der Sammlung The Nick Adams Stories enthalten. Die Erstveröffentlichung in Paris (in Three Stories and Ten Poems, 1923), hatte den Vorteil, dass Liz und Jim Dilworth sie nicht zu Gesicht bekamen. Am 12. Januar 1936 schreibt Hemingway allerdings in einem Brief, die Geschichte sei noch unveröffentlicht. Er wird dabei die kleine Publikation aus Paris schon vergessen haben. Aber davon abgesehen erschien „Oben in Michigan“ in Hemingways Verlag Scribner in der Tat erst in 1938.
Die Geschichte war zuvor vom Verlag aus dem Kurzgeschichtenband In Our Time, der in 1925 in den USA veröffentlicht wurde, herausgenommen worden. Hemingway entrüstet sich darüber in einem Brief an John Dos Passos: „Sie haben mich die Geschichte ‚Oben in Michigan’ herausnehmen lassen, weil das Mädchen da zum ersten Mal einen verpasst kriegt, und ich habe ihnen eine prima Nick-Geschichte geschickt über einen kaputten Boxer und einen Nigger … Diese Kämpfer-Geschichte ist verteufelt gut und besser als Oben in Mich., obwohl mir Oben in Mich. immer gefallen hat, wenn auch anderen nicht.“
Die Story ist simpel, fast ohne Handlung. Jim, ein Schmied, kommt nach Horton Bay und kauft die dortige Schmiede. Die junge Frau, die im Restaurant der Smiths arbeitet, verliebt sich in Jim, der sie jedoch kaum beachtet. Jim, der Restaurantbesitzer Smith und ein dritter Mann gehen auf einen Jagdausflug. Liz sehnt sich nach Jim. Als die Jagdgesellschaft zurückkehrt, nimmt man zur Feier des Tages einige Drinks. Nach dem Abendessen und noch mehr Drinks geht Jim in die Küche, in der Liz auf einem Stuhl sitzt. Er umarmt und küsst sie, berührt ihre Brüste und flüstert: „Lass uns woanders hingehen.“ Sie gehen zur Bay hinunter, wo Jims Hände den Körper von Liz erkunden. Sie ist verängstigt, sagt ihm immer wieder, nein, sie will nicht, lässt ihn aber schließlich gewähren. Hier der Schluss der Geschichte:
Die Planken des Stegs waren hart und kalt und splittrig und Jim lag schwer auf ihr und er hatte ihr wehgetan. Liz stieß ihn an, sie lag so unbequem und verkrampft. Jim war eingeschlafen. Er würde sich nicht bewegen. Sie arbeitete sich unter ihm hervor und setzte sich auf und richtete ihren Rock und Mantel und versuchte, etwas mit ihren Haaren zu tun. Jim schlief, sein Mund war ein wenig geöffnet. Liz beugte sich vor und küsste ihn auf die Wange. Er schlief noch. Sie hob seinen Kopf ein wenig und schüttelte ihn. Er drehte ihn zur Seite und schluckte. Liz fing an zu weinen. Sie ging näher an den Rand des Stegs und blickte hinunter zum Wasser. Nebel stieg aus der Bucht. Ihr war kalt und elend zumute und sie fühlte, alles war vorbei. Sie ging zurück, wo Jim lag und schüttelte ihn noch einmal, um sich zu vergewissern. Sie weinte.
„Jim“, sagte sie. „Jim. Bitte, Jim.“
Jim rührte sich und rollte sich ein wenig enger zusammen. Liz zog ihren Mantel aus und beugte sich vor und deckte ihn damit zu. Sie stopfte ihn ordentlich und sorgfältig um ihn herum fest. Dann ging sie über den Steg und den steilen sandigen Weg hoch, um ins Bett zu gehen. Ein kalter Nebel kam durch die Wälder über die Bucht.
Die Geschichte ist harsch und gefühllos mit Ausnahme der Figur der Liz. Eine schwärmerische Liebe einer jungen, unerfahrenen Frau zu dem älteren Jim, die weder romantisch noch erotisch erfüllt wird. Mit dem Kuss auf die Wange, den sie ihm nach seinem rücksichtlosen Eindringen in ihren Körper und dem lieblosen Verhalten danach gibt, drückt sie ihre fortdauernde Liebe aus und versucht, eine Reaktion von ihm zu erhalten. Als dies nicht geschieht, fühlt sie, dass alles vorbei ist, und weint.
Das eigentlich Faszinierende an der Geschichte ist, dass Hemingway die Fantasien einer unerfahrenen Frau versteht und sensibel ihre widerstreitenden Gefühle beschreibt, selbst als es zum brutalen Ende kommt. Wie er es schafft, mit knappen Worten die verletzte Seele dieser jungen Frau aufzuzeigen, wie er Liz’ Erkenntnis darüber andeutet, dass Jim einfach nur seine körperlichen Gelüste befriedigen wollte, und wie er Zärtlichkeit erst beschreibt, als alles vorbei ist, die Sehnsucht erloschen und die Hoffnung vergangen ist, dies alles zeigt bereits den großen Schriftsteller, der er einmal werden sollte.
Sehr viel später, 1936, gibt es eine Meinungsäußerung von Hemingway über die Story, die gerade aufgrund des Endes bemerkenswert ist: „Diese Geschichte nimmt in meinem Werk eine wichtige Rolle ein und hat viele Leute beeinflusst. Callaghan usw. Sie ist nicht schmutzig, sondern traurig. Damals habe ich noch nicht so gut geschrieben, besonders Dialoge. Ein großer Teil der Dialoge in der Geschichte ist sehr hölzern. Aber da an der Anlegestelle, wurde sie auf einmal vollkommen echt, das ist der Clou der ganzen Geschichte, und für mich war es der Anfang all der Natürlichkeit, die ich dann hatte.”

 Der Großschriftsteller wurde vor 125 Jahren, am 21. Juli 1899, geboren.
Der Großschriftsteller wurde vor 125 Jahren, am 21. Juli 1899, geboren.




 Der neuste Lyrikband von Sybille Fritsch, „DA! Gedichte“, beschwört durch die Dichtkunst eine Metaphysik des Dauernden im Flüchtigen.
Der neuste Lyrikband von Sybille Fritsch, „DA! Gedichte“, beschwört durch die Dichtkunst eine Metaphysik des Dauernden im Flüchtigen.


















 Seit 1998 wird im Hamburger Museum der Arbeit, die Messe BuchdruckKunst veranstaltet. Der Name sagt zwar fast alles aus, aber wenn man hingeht, öffnen sich dem Betrachter neue Welten.
Seit 1998 wird im Hamburger Museum der Arbeit, die Messe BuchdruckKunst veranstaltet. Der Name sagt zwar fast alles aus, aber wenn man hingeht, öffnen sich dem Betrachter neue Welten. Für mich als Journalist beginnt die Qual der Auswahl, was ich dem geneigten Leser näherbringen möchte. Ich habe mich auf fünf Beispiele konzentriert, die unterschiedlicher im Handwerk nicht sein können. Beginnen möchte ich mit der Grafikerin Sabine Riemenschneider aus Wernigerode, die in Kleinstauflagen Bücher im Digitaldruck produziert. Im Bild zu sehen ist eine Papierrolle, auf der durch Stanzung Töne einer Orgel gespeichert und automatisch abgespielt werden können. Dieses Papierunikat hat sie bemalt und beschriftet. Um es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat sie es nach der Reproduktion digital in ein großformatiges Leporello-Buch ganz ähnlich wie dieses endlos lange Papier gedruckt.
Für mich als Journalist beginnt die Qual der Auswahl, was ich dem geneigten Leser näherbringen möchte. Ich habe mich auf fünf Beispiele konzentriert, die unterschiedlicher im Handwerk nicht sein können. Beginnen möchte ich mit der Grafikerin Sabine Riemenschneider aus Wernigerode, die in Kleinstauflagen Bücher im Digitaldruck produziert. Im Bild zu sehen ist eine Papierrolle, auf der durch Stanzung Töne einer Orgel gespeichert und automatisch abgespielt werden können. Dieses Papierunikat hat sie bemalt und beschriftet. Um es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat sie es nach der Reproduktion digital in ein großformatiges Leporello-Buch ganz ähnlich wie dieses endlos lange Papier gedruckt. Blättert man das Buch, wie im Foto gezeigt, schräg auf, ergibt sich unter dem Goldschnitt eine weitere Malerei. Meuter benennt es mit dem Fachausdruck „unterbemalter Goldschnitt“. Das sind Unikate mit Aquarellfarbe, die erst dann sichtbar sind, wenn man den Buchblock schräg aufblättert: Höchst künstlerisch.
Blättert man das Buch, wie im Foto gezeigt, schräg auf, ergibt sich unter dem Goldschnitt eine weitere Malerei. Meuter benennt es mit dem Fachausdruck „unterbemalter Goldschnitt“. Das sind Unikate mit Aquarellfarbe, die erst dann sichtbar sind, wenn man den Buchblock schräg aufblättert: Höchst künstlerisch.





 Am 25. Februar 2024 veranstaltete der Büchermacher Ralf Plenz in Kooperation mit der Hamburger Autorenvereinigung ein Treffen der Pirckheimer Gesellschaft in Hamburg-Altona. In der Alfred-Schnittke-Akademie konnten Interessierte sich über die Institutionen informieren, bibliophile Buchausgaben bewundern und erstehen. Dabei ging es auch um die Frage, was der Begriff „bibliophil“ denn eigentlich umfasst.
Am 25. Februar 2024 veranstaltete der Büchermacher Ralf Plenz in Kooperation mit der Hamburger Autorenvereinigung ein Treffen der Pirckheimer Gesellschaft in Hamburg-Altona. In der Alfred-Schnittke-Akademie konnten Interessierte sich über die Institutionen informieren, bibliophile Buchausgaben bewundern und erstehen. Dabei ging es auch um die Frage, was der Begriff „bibliophil“ denn eigentlich umfasst.












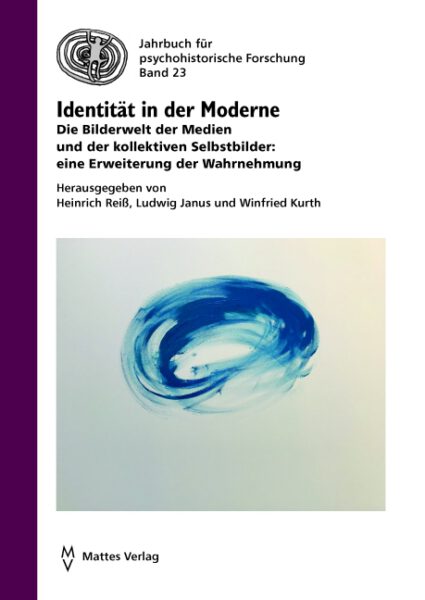 Wie Brian De Palma die Hyperrealität vorwegnahm
Wie Brian De Palma die Hyperrealität vorwegnahm