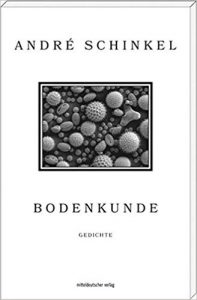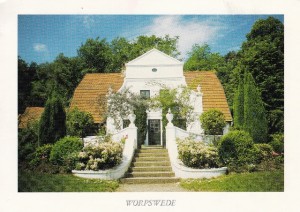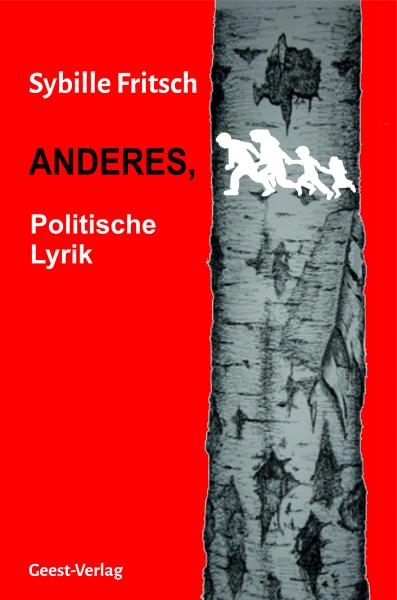
„In meiner Lyrik spielte die Politik bisher keine tragende Rolle.“ (Sybille Fritsch: Anderes, Politische Lyrik, Geest-Verlag 2025, S. 5)
Die neueste Sammlung von Sybille Fritsch ist tatsächlich für sie selbst und für ihre Leserschaft thematisch und stilistisch Neuland. Fritschs Gefühl: „Je weiter ich schrieb, desto mehr haben sich mir die Gedichte aufgedrängt, die in diesem Band zusammengefasst … werden“ (ebenda S. 5) und auch Rilkes Empfindung „Es schreibt mich“ (19.05.1924) können alle Lyriker/innen nachvollziehen.
Politische Lyrik ist seit Jahrhunderten in der deutschsprachigen Literatur fest verankert. Fritschs neueste Texte sind allgemein von derselben politisch liberal-demokratischen Einstellung wie zum Beispiel Heines gesellschaftskritische Gedichte. So könnte man behaupten, Fritschs Texte seien in deren Neigung innovativ „zu Hause“.
Ist dieser Aufbruch zum Politischen nötig gewesen? Anhand der Weltsituation muss die Antwort auf diese Frage ein klares „Ja“ sein. Der Schritt zur unverblümten Bloßstellung und Anprangerung der Fortschritte des Bösen war fällig. Um spezifisch zu sein: Schweigen, Wegducken; Gebrüll, Müll vom deutschen Wesen (S. 19), Kinder auf dem Gewissen (S. 21), Friede (der) Krieg bedeutet (S. 22), Gier (S. 23-25), Unrechtsschluchten (S. 26) (keine ) Friedensallee, Floskeln, Probleme … als Waffe, Der braune Ausweg (S. 28) , Europa will keine Flüchtlinge … Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt (S. 30) wechselhaftbefehl (S. 31).
In Teil 2 der Sammlung, „Klima Mit Weltrevolution“ (Texte S. 37-52) geht es um Reife; das System der menschlich-gesellschaftlichen Werte, die einen Zyklus bilden sollten, ist demontiert (S. 40-41). Eine „negative Revolution“ entwickelt einen Gegenzyklus, der „die eigenen Kinder frisst“ und den Status quo der Ungerechtigkeiten der „Vorzeit“ wieder aufleben lässt. In diesem Teil verwendet Fritsch Ausdrücke aus dem Alltag und „mischt“ sie neu.
Die Sprache und Stilmerkmale von Frieden, Krieg, Verzeihn, Shalom in Teil 3 (S. 57 ff) beschwören eine Wiederkehr Richtung reflektierter und verinnerlichter Bedeutung und Wirkung des neu zu gewinnenden „Sachverstands“. Auf den Seiten 61 64 z.B. handelt es sich um Verzicht auf Materielles zu Gunsten des inneren Weges: Lukas 9:3, 10:4 Matthias 10:9 Johannes 12:24. Trotz aller sich hieraus ergebender Hoffnung auf eine Änderung auch im Äußeren, „Hinterm Horizont gehts … weiter“ (S. 65). Wir ziehen unsere Komfortzone dem Erwachen vor: „alles über sich hinaus/Wollende nicht erwünscht (S. 69). Man kann in seinem eigenen Land doch ein „Außenseiter“ sein (S. 80). Auch ein Echo aus dem Markus Evangelium 6:4.
Fritsch findet zusammengefasst in diesem Band ein Idiom klarer Adressenorientierung, die noch emotional anspricht und gleichzeitig zu einem sich aktiv entwickelnden soziopolitischen Bewusstsein aufruft. Die besondere Stimme des Bandes verdankt sich gleichzeitig der Politik und der Literatur, denn Fritsch schreibt mit Fantasie und benutzt Sprache als Medium zur Erforschung menschlicher Erfahrung, um sowohl kulturelle und soziale Reflexion als auch universelle Themen zu vergegenwärtigen. Kurz gesagt, fällt weder das Lyrische dem Politischen zum Opfer noch schwächt das Lyrische die gesamte politische Aussage.
Sybille Fritsch
lebt in Hannover und Windheim an der Weser und war längere Zeit im Oberharz zu Hause.
Lyrikerin, Religionswissenschaftlerin, Philosophin. Seit einiger Zeit verfasst sie auch lyrische Prosa.
Mitglied verschiedener literarischer Vereinigungen.
Gedichte veröffentlichte sie in deutschsprachigen Anthologien seit den Achtzigerjahren. Bisher vier eigenständige Lyrikbände. Zuletzt im Geest-Verlag ‚DA!‘. Gedichte (2024)
Link zum Buch: https://geest-verlag.de/news/sybille-fritsch-anderes-politische-lyrik-druck

 Der neuste Lyrikband von Sybille Fritsch, „DA! Gedichte“, beschwört durch die Dichtkunst eine Metaphysik des Dauernden im Flüchtigen.
Der neuste Lyrikband von Sybille Fritsch, „DA! Gedichte“, beschwört durch die Dichtkunst eine Metaphysik des Dauernden im Flüchtigen. Als ich, frisch gebackene Sekretärin der Hamburger Autorenvereinigung, mit dem Korrekturlesen der Beiträge für die Anthologie „Spuk in Hamburg“ (Verlag Expeditionen, Hamburg 2014) befasst war, beeindruckten mich zwei Gedichte eines Lyrikers besonders, den ich bislang nur vom Sehen kannte. Dieser Lyriker arbeitete sehr traditionell, mit einem packend bildhaften und eloquenten Wortschatz, geschliffenem Metrum und gestochenem Versmaß. Wer war dieser Mensch, der einer offiziellen Version der Gattung Lyrik „linksbündiger Flattersatz“ mit althergebrachter Wortgewaltigkeit trotzte?
Als ich, frisch gebackene Sekretärin der Hamburger Autorenvereinigung, mit dem Korrekturlesen der Beiträge für die Anthologie „Spuk in Hamburg“ (Verlag Expeditionen, Hamburg 2014) befasst war, beeindruckten mich zwei Gedichte eines Lyrikers besonders, den ich bislang nur vom Sehen kannte. Dieser Lyriker arbeitete sehr traditionell, mit einem packend bildhaften und eloquenten Wortschatz, geschliffenem Metrum und gestochenem Versmaß. Wer war dieser Mensch, der einer offiziellen Version der Gattung Lyrik „linksbündiger Flattersatz“ mit althergebrachter Wortgewaltigkeit trotzte?




 Das Buch von Reimer Boy Eilers: eigenwillig, ungewöhnlich, auf jeden Fall interessant. Ausgerechnet im Ramadan segelt der Held von Sansibars Nordwestküste aus zur sechs Kilometer vorgelagerten Insel Tumbatu. Tumbatu ist ein von Saumriffen umgebenes Eiland, verwunschen, dünn besiedelt, geheimnisvoll. Kein Wunder, dass dort, Erzählungen nach, irgendwo am Ufer ein heiliger Baum wachsen soll, vor dem einst eine Dhau, beladen mit Sklaven, wahrscheinlich aus dem Kongo, havarierte. Die Überfahrt mit einer einheimischen Crew und einem mysteriösen Geistheiler an Bord, ist zwar nur von kurzer Dauer, dennoch strapaziös. Der Held, ein weißer Tourist, leidet an diesem mörderisch heißen Tag an Wahnvorstellungen infolge quälenden Durstes. Wie Trugbilder erscheinen ihm Szenen von Sklaven, die auf eine Dhau gepfercht, eigentlich auf dem größten Sklavenmarkt Afrikas verkauft werden sollen. Das Riff macht sie zu Schiffbrüchigen, die verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Der Sklavenmarkt befindet sich auf Sansibar. Dort regiert der Sultan von Oman und Sansibar, ein unermesslich reicher Araber, der durch Sklaven, Sklavenhandel und Gewürznelken seinen Reichtum erwarb. Lieferant der Menschenfracht ist Tippu Tip, ein mächtiger Sklaven- und Elfenbeinhändler. Selbst mit dunkler Hautfarbe geboren, signalisiert er Vertrauen unter den Einheimischen Zentralafrikas. Lächelnd wickelt er seine Mitmenschen ein. Tritt der wahre, der grausame Händler hinter seiner Maske hervor, ist es zu spät. Er lässt Menschen aus dem Kongo jagen, treibt sie an die Küste, wo sie auf Schiffe verfrachtet, über den Sansibar-Kanal nach Stone Town auf den Sklavenmarkt geschleppt und verkauft werden. Sklavenschiffe kreuzten in jener Zeit überall auf den Weltmeeren. Geortet wurden sie an ihren Gestanksfahnen, die sie meilenweit hinter sich herzogen. Was es nun mit der Sklaven-Dhau, die da am Riff vor Tumbatu, in der Nähe des heiligen Baums zerschellte, auf sich hat, soll nicht verraten werden. Nur so viel: Der Autor führt uns auf eindringliche Weise die Schrecken der Sklaverei vor Augen. Nicht in Form aufrüttelnder Prosa, nein, mit einem epischen Gedicht, durch das man sich von wachsender Neugierde und Anteilnahme getrieben, durcharbeitet.
Das Buch von Reimer Boy Eilers: eigenwillig, ungewöhnlich, auf jeden Fall interessant. Ausgerechnet im Ramadan segelt der Held von Sansibars Nordwestküste aus zur sechs Kilometer vorgelagerten Insel Tumbatu. Tumbatu ist ein von Saumriffen umgebenes Eiland, verwunschen, dünn besiedelt, geheimnisvoll. Kein Wunder, dass dort, Erzählungen nach, irgendwo am Ufer ein heiliger Baum wachsen soll, vor dem einst eine Dhau, beladen mit Sklaven, wahrscheinlich aus dem Kongo, havarierte. Die Überfahrt mit einer einheimischen Crew und einem mysteriösen Geistheiler an Bord, ist zwar nur von kurzer Dauer, dennoch strapaziös. Der Held, ein weißer Tourist, leidet an diesem mörderisch heißen Tag an Wahnvorstellungen infolge quälenden Durstes. Wie Trugbilder erscheinen ihm Szenen von Sklaven, die auf eine Dhau gepfercht, eigentlich auf dem größten Sklavenmarkt Afrikas verkauft werden sollen. Das Riff macht sie zu Schiffbrüchigen, die verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Der Sklavenmarkt befindet sich auf Sansibar. Dort regiert der Sultan von Oman und Sansibar, ein unermesslich reicher Araber, der durch Sklaven, Sklavenhandel und Gewürznelken seinen Reichtum erwarb. Lieferant der Menschenfracht ist Tippu Tip, ein mächtiger Sklaven- und Elfenbeinhändler. Selbst mit dunkler Hautfarbe geboren, signalisiert er Vertrauen unter den Einheimischen Zentralafrikas. Lächelnd wickelt er seine Mitmenschen ein. Tritt der wahre, der grausame Händler hinter seiner Maske hervor, ist es zu spät. Er lässt Menschen aus dem Kongo jagen, treibt sie an die Küste, wo sie auf Schiffe verfrachtet, über den Sansibar-Kanal nach Stone Town auf den Sklavenmarkt geschleppt und verkauft werden. Sklavenschiffe kreuzten in jener Zeit überall auf den Weltmeeren. Geortet wurden sie an ihren Gestanksfahnen, die sie meilenweit hinter sich herzogen. Was es nun mit der Sklaven-Dhau, die da am Riff vor Tumbatu, in der Nähe des heiligen Baums zerschellte, auf sich hat, soll nicht verraten werden. Nur so viel: Der Autor führt uns auf eindringliche Weise die Schrecken der Sklaverei vor Augen. Nicht in Form aufrüttelnder Prosa, nein, mit einem epischen Gedicht, durch das man sich von wachsender Neugierde und Anteilnahme getrieben, durcharbeitet.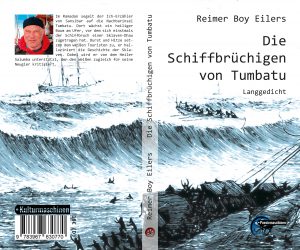


 Das leichte, hintergründige Lächeln ist verglommen. Der rote Schal hängt am Garderobenhaken, die schwarze Baskenmütze baumelt darüber. Doch der Mann mit diesen äußerlichen Attributen ist gegangen.
Das leichte, hintergründige Lächeln ist verglommen. Der rote Schal hängt am Garderobenhaken, die schwarze Baskenmütze baumelt darüber. Doch der Mann mit diesen äußerlichen Attributen ist gegangen.