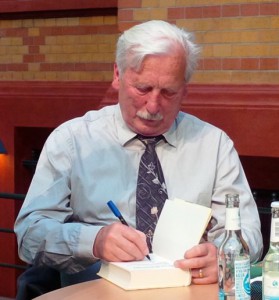
Foto: Maren Schönfeld
von Maren Schönfeld
zur Buchvorstellung von Arno Surminski: „Als der Krieg zu Ende ging“
„In Karaganda ist immer Sommer“, denkt die namenlose Frau, nachdem sie mehr als fünfzig Jahre nach der Verschleppung der Eltern einen Brief erhält und erfährt, dass Vater und Mutter in Karaganda gestorben sind. Längst lebt sie in dem Land, „zu dem das Kind gehörte“ [S. 53], wuchs ohne die leiblichen Eltern bei einer anderen Familie auf. Schon vor der Frage des Lektors nach der Autobiografie ist klar: Dies ist Arno Surminskis eigene Geschichte. Er hat nur aus dem kleinen Jungen, der er war, für den Text ein kleines Mädchen gemacht. Eine Autobiografie zu schreiben traue er sich nicht zu, sagt Surminski, dabei schreibt er doch eigentlich längst daran, hat schon mit seinem ersten Buch „Jokehnen“ daran geschrieben.
Arno Surminski stellte am heutigen Abend seinen siebten Band mit Erzählungen mit dem Titel „Als der Krieg zu Ende ging“ im Atrium der HanseMerkur-Versicherung vor. Es war die 21. Buchvorstellung Surminskis bei der Versicherungsgruppe, wie der Vorstandsvorsitzende Eberhard Sautter zur Begrüßung sagte. Der Verleger Gerhard Richter des Verlags Ellert & Richter ging in seiner Ansprache der Frage nach, wann denn der Krieg wirklich zu Ende gewesen sei, denn das ist wohl eine sehr persönliche Frage. Am 8. Mai 1945, nach Rückkehr aus der Gefangenschaft – oder erst nach dem Ende der DDR? Für Arno Surminski ging er 1946/47 zu Ende, als der Junge in Trittau ankam, wo er von der Familie einer Verwandten aufgenommen wurde, die bereits sechs Kinder hatte. Dass er das erst im Alter so richtig zu würdigen wisse, bedauere er.
In den vorliegenden Erzählungen beschreibt Surminski nicht den Krieg, sondern das persönliche Schicksal Einzelner und eben die Zeit des Kriegsendes, ohne Angriffe und Kriegsgeschehen. Manchmal wirkt es fast wie eine Schocksekunde, die er da aufgezeichnet hat – die Kämpfe sind vorbei, aber was kommt nun? Er versteht es, die Figuren mit wenigen Worten authentisch zu zeichnen, Figuren, die nicht toben und schreien, sondern die mit leisen Tönen umso eindringlicher wirken. Stumm sei das alles auch geschehen, so Surminski im Gespräch mit seinem Lektor Dr. Werner Irro. Verschleppungen wurden nicht benannt, sondern die Soldaten sprachen vom Bahnhof, an dem die Eltern arbeiten müssten. Die Kinder dachten, die Eltern kämen im Sommer zurück – auch der kleine Arno dachte es, doch seine Eltern waren da längst in „Karaganda“, was eigentlich viel zu schön klingt. Es wurde auch nicht auf Menschen geschossen, sondern auf die Krähenschwärme in den Bäumen. Es ist ein Lieblingsbild des Autors, das in seinen Texten mehrfach wiederkehrt: die in den Bäumen sitzenden Todesvögel.
Surminskis Figuren sind still und zu großen Gesten fähig. Da ist die alte Frau, die nach dem Wegfall der Grenzen in das Haus zurückkehrt, in dem sie damals ihren neugeborenen Sohn der Bäuerin überließ. Der inzwischen „stattliche Mann“ weiß nichts von alledem, die Bäuerin ist tot – und die Frau reist wieder ab, ohne sich als Mutter zu erkennen zu geben. Denn sie weiß nun, die Bäuerin hat Wort gehalten, ihrem Sohn war es gut ergangen. Jetzt ist auch für sie der Krieg zu Ende. Im Gespräch mit Dr. Irro erzählt Surminski, es habe so einen Fall tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Überhaupt seien seine Impulse für Geschichten die eigenen Erfahrungen oder Gehörtes. Als kleiner Junge hörte er, wie die Briefträgerin seiner Mutter ihr Leid klagte, wie schwer es sei, durch den Schnee zu radeln und Todesnachrichten zu überbringen. Diese Erinnerung inspirierte den Autor zu seiner Erzählung „Verlorene Briefe“, in der ein Aushilfs-Briefträger in die Verlegenheit kommt, während der Weihnachtszeit die Briefe in einer Farbe wie „das Grau umgebrochener Erde“ [S. 37] zustellen zu sollen, die ebenjene Todesnachrichten enthalten – und wie er diese Aufgabe schließlich zu umgehen weiß und den Familien so ihre Hoffnung lässt. Auch die verzweifelte Hoffnung des Protagonisten schimmert da hindurch, dass so viele Tote doch einfach nicht sein dürfen.
Und auch Orte sind still, wenn alle Menschen fort sind und die Störche nicht zurückkommen. [Frühling ohne Störche]
Surminski erzählt in einfacher, doch klangvoller Sprache und lässt zwischen den Zeilen viel Raum für den Dialog mit dem Leser. Hinter den kleinen Episoden entfaltet sich die traurige Tragweite der Schicksale.
Dr. Irro berichtet aus der „Werkstatt“, wie schwierig es sei, Surminski von einzelnen Sprachwendungen zu überzeugen: „Eschenbaum“ klinge in diesem Satz eben besser als „Esche“ und so müsse es nach Wunsch des Autors stehenbleiben [S. 50].
Arno Surminski ist „old school“: Ihm reichen nicht das Vermitteln der Information und die leichte Lesbarkeit, sondern er versteht Sprache als Werkzeug und erzählerische Komponente und schafft somit ein Lese-Erlebnis auf mehreren Ebenen. Er vermeidet Fremdwörter, wo möglich. Sätze und Ortsbezeichnungen sind klug durchdacht und klanglich durchkomponiert. „Jäglack“, der Geburtsort Arno Surminskis, eignet sich nach seiner Ansicht nicht für eine literarische Verwertung, so hat er das klangvolle „Jokehnen“ dafür ersonnen. Das Wort „sich“ findet er etwas hilflos und „dass“ mag er auch nicht. Dafür ist „o“ sein liebster Vokal. Dr. Irro hat recht, wenn er sagt, dass man diese klangliche Arbeit spüren kann, auch wenn man den Text nicht analysiert.
Durch die Vergangenheitsform und die Autorenperspektive ist Surminskis Erzählstil unaufgeregt, gleichmäßig, vielleicht sogar etwas distanziert. Er verwendet manchmal Phrasen, kombiniert sie aber mit seinen eigenen Bildern: „Und weiter lief die Zeit ihren gewohnten Gang. Sie überrannte das Jahrhundert und die Länder. (…) Schließlich überrannte die Zeit die Grenze, das letzte Überbleibsel des Krieges.“ [S. 13] Dadurch schafft er die Anbindung an das Jetzt. Die Unaufgeregtheit wird auch typografisch unterstützt, indem auf Anführungszeichen bei der wörtlichen Rede verzichtet wurde.
In Arno Surminskis Erzählungen kommen Menschen vor, die „Erika Zarkan“ [Als der Krieg zu Ende ging] oder „Günther Schneider“ [Chor der Gefangenen] heißen. Vielleicht ist das für eine literarische Kreation nicht besonders einfallsreich, aber es zeigt, dass es sich hier um Menschen wie du und ich handelt, es geht um unsereins, wir hätten das auch sein können. Und zwar nicht vor siebzig Jahren, sondern heute, in Syrien oder in Osteuropa, zum Beispiel.
Arno Surminskis Prämisse lautet: Nie wieder Krieg. Er schrieb die Erzählungen dieses Buches in den letzten drei bis vier Jahren. Und er hat dabei auch die aktuellen Kriegsschauplätze im Kopf, vielleicht noch mehr im Herzen gehabt. In Ostpreußen verkündete niemand am 8. Mai 1945 das Kriegsende. Der Junge Arno wunderte sich nur über die vielen Flugzeuge, die ohne Kriegshandlungen gen Westen flogen. Und plötzlich war ihm klar: Die fliegen nach Hause. Der Krieg war vorbei.
Die Erzählungen dieses neuen Bandes jedoch sind nicht von Gestern. Gerade die Vereinzelung und Vergrößerung der Ereignisse wirken der Abstumpfung durch das vielfach Gehörte entgegen. Diese Texte setzen sich in einem fest. Und das ist gut so.
Arno Surminski: Als der Krieg zu Ende ging – Erzählungen
Ellert & Richter Verlag, 208 S., geb.
Von Arno Surminski sind mehrere Bücher bei Ellert & Richter erschienen.
Link zum Verlag: www.ellert-richter.de
