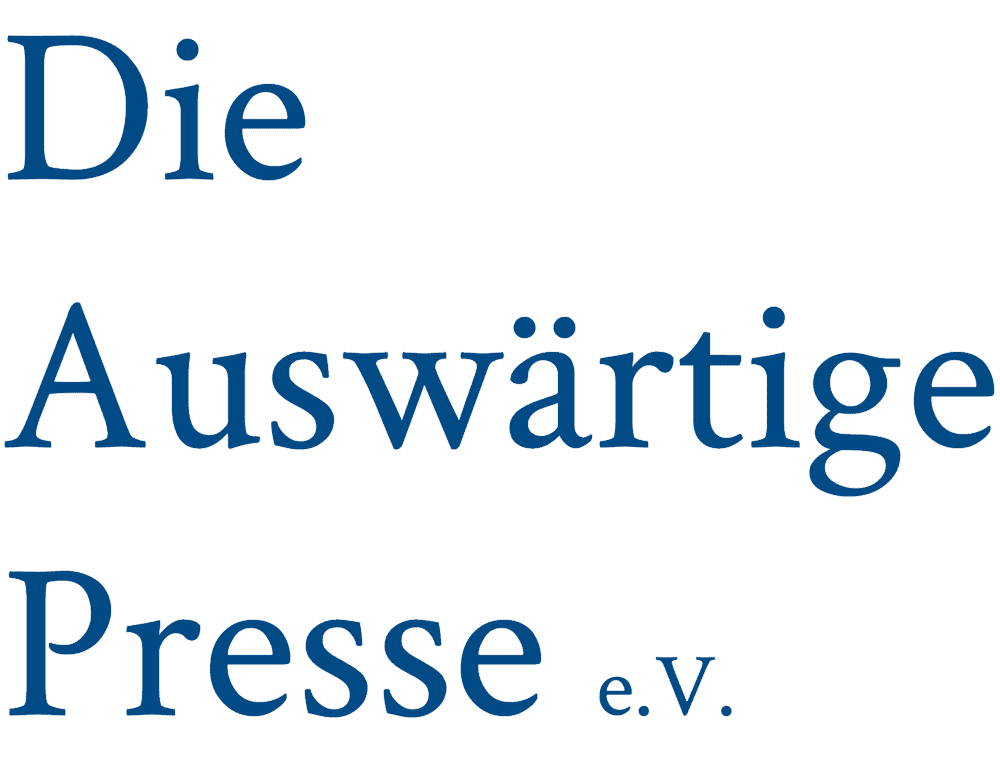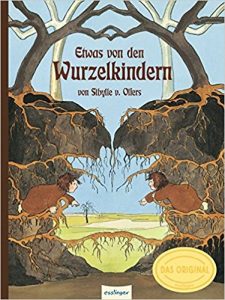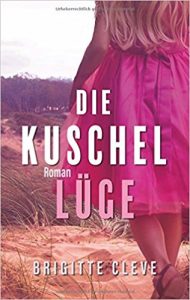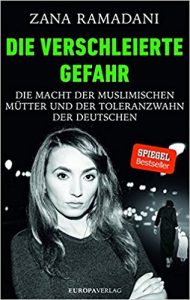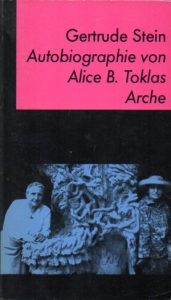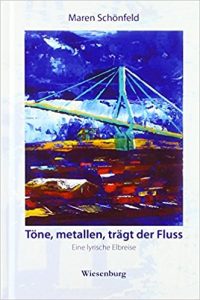
Dieses kleine Buch – es umfasst knapp 80 Seiten – hebt sich wohltuend von so manchem Werk ab, das sich wortreich mit den Befindlichkeiten Hamburgs beschäftigt und allzu oft dieselben Sujets in den Mittelpunkt stellt. Mit „Töne, metallen, trägt der Fluss“ hat Maren Schönfeld einen Band vorgelegt, der Lyrik und Prosa rund um Geschichten und Geschicke der Hansestadt elegant mit einander verbindet.
Postkartenromantik ist nicht die Sache der Autorin. Sie richtet ihr Augenmerk nicht auf die allseits bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern leuchtet völlig andere Aspekte aus. Und dies in der ihr eigenen klaren Sprache. Das Gedicht „Heute Nacht“ ist ein besonders schönes Beispiel ihres schnörkellosen Stils: „Durch die Zahnlücken / der Stadt pfeift / Sturm heute Nacht // das Lied der verlorenen / Gedanken, die wir suchen“ Dem Stadtteil Ottensen – im Volksmund „Mottenburg“, in welchem Maren Schönfeld seit Langem wohnt, widmet sie vier Strophen, in welchen sie den Wandel eines ehemaligen Industriestandortes mit rauchenden Schornsteinen und rußigen Häuserfassaden in einen sogenannten „In“-Stadtteil beschreibt. Hier im ehemaligen Quartier der armen Glasbläser, deren Lungen durch ihr aufreibendes Metier irreparable Schäden erlitten, die der Volksmund sarkastisch „Motten“ nannte, leben heute vornehmlich Künstler und arrivierte junge Leute, die gern ihren Latte Macchiato in einem der vielen Cafés und Bistros genießen. Sie wissen nichts von dem Elend, in welchem die Altvorderen dieses Quartiers einst ihr Leben fristeten. Continue reading „Lyrischer Spaziergang an den Gestaden der Elbe“