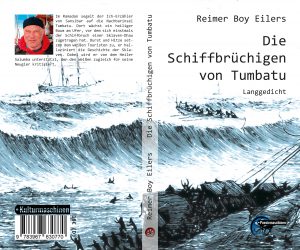In seinem jüngst erschienenen Buch „Zwischen Hamburg und der Ferne“ lädt uns der bekannte Schriftsteller Wolf Cropp auf eine Reise rund um die Welt ein. Leichtfüßig bewegt er sich zwischen der Hansestadt und zahlreichen Ländern auf der nördlichen und südlichen Halbkugel unseres Globus. In Insgesamt zweiundvierzig völlig voneinander unabhängigen Erzählungen gewährt der Autor dem Leser einen Einblick in sein abenteuerliches Leben, das ihn stets fernab der ausgetretenen touristischen Pfade nicht nur in die interessantesten, sondern häufig auch gefährlichsten Regionen des Planeten führten.
Die Reise um die Welt beginnt vor der Haustür

Ein kluger Fahrensmann sagte einst, dass einer, der die Welt erkunden will, zuerst seine Heimat richtig kennenlernen solle. Dann erst habe er das Rüstzeug für die weite Ferne. Folgerichtig beginnt Cropp seinen Erzählzyklus in seiner Vaterstadt Hamburg. „Kampfplatz Stadtpark“ berichtet von einem gefährlichen Abenteuer, das er und seine Spielkameraden nach 1945 in der vom Krieg zerstörten Hansestadt zu bestehen hatten. Vielleicht war dieses Erlebnis zusammen mit anderen gewagten „Aktionen“ auch die Feuertaufe für diesen drahtigen Mann, der auf seinem weiteren Lebensweg nie einer Herausforderung auf dem Weg ging.
Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen

Wer kann sich etwas Schöneres vorstellen als die Inseln der Südsee? So verschlug es den Autor nach Moorea, Tahiti, wo er mit dem „Inselschreck“ Bekanntschaft schloss. Mit den Füßen im Stillen Ozean plätschernd, überlegte er sich, wie er zu Wasser nach Papeete gelangen könnte, mietete ein Auslegerkanu und landete in der Tat am Ziel seiner Träume, trotz der Warnung eines Einheimischen, er könne zwar heil in Tahiti ankommen, aber auch bei ungünstiger Strömung auf dem offenen Meer verloren gehen. Hatte der Waghalsige nur Glück oder war er einfach ein begnadeter Navigator? Wir vermuten letzteres. Von dieser Tour de Force etwas erschöpft, wandelt Cropp beseelt auf den Spuren des Malers Paul Gauguin und lässt uns an der tragischen Lebensgeschichte des Malers teilhaben. Der Künstler erträumte sich einen Garten Eden in der Südsee, frei von allen Konventionen der westlichen Zivilisation, fand aber zu seinem Leidwesen eine durch die französische Kolonialherrschaft zerstörte autochthone Kultur vor. Quelle déception! Dennoch schuf er wunderbarer Gemälde, die zwar zu seinen Lebzeiten niemand kaufen wollte, die aber heute unbezahlbar sind. Ein Schicksal, das er mit anderen genialen Künstlern teilt. Man denke nur an Vincent van Gogh.

Auf den „Marktbesuch“ im westafrikanischen Benin folgen spannende Geschichten auf dem „Transalaska Highway“ sowie eine „Kreuzfahrt ins ewige Eis“ Alaskas. Ferner erfahren wir, dass am Sambesi „Die Hölle stinkt.“ Es gehört schon viel Mut dazu, sich auf eine „entspannte Bootsfahrt“ oberhalb der Victoriafälle zu begeben. Noch viel gefährlicher aber sind die Gewässer darunter, in denen hungrige Krokodile leben und auf Beute lauern. Doch auch diesen Höllentrip übersteht Cropp mit einem Lächeln auf den Lippen, als er gleich zwei der riesigen Echsen mit weit aufgerissenen Mäulern neben seinem Boot erblickt. Nach einem solchen Abenteuer mutet der Ausflug in die Wüste im Tschad zwar auf den ersten Blick wie ein Spaziergang an, entpuppt sich jedoch als Ausflug voller Tücken. Als der Autor die Orientierung verliert, verlassen ihn bald seine Kräfte. Völlig erschöpft legt er sich im Wüstensand zum Schlaf nieder: „Ich suchte den Boden ab. Schwarzkäfer bohrten sich in den Grund. Skinke huschten über den Sand. Ein Skorpion hastete davon. Eine Hornpiper grub sich ein. Der Abendwind blies sie weg, die letzten Lebensspuren…“ Aber auch aus dieser prekären Lage arbeitet sich Cropp heraus, der offenbar wie eine Katze über sieben Leben verfügt. Der wunderbaren Geschichten sind viele in diesem lesenswerten Buch. Eine der anrührendsten ist jene, in der sich der Autor auf die Suche nach dem verlorenen Sohn eines Freundes in Thailand begibt und diesen nach endlosen Umwegen auch findet.
Kein Platz für Märchen

Wenn auch manche Erzählungen etwas fantastisch anmuten, so haben wir es im Autor Cropp nicht etwa mit einem Claas Relotius zu tun, der den „Spiegel“ vor nicht langer Zeit mit Geschichten beglückte, die ausschließlich seiner allzu lebhaften Fantasie entsprangen. Keines von Cropps Abenteuern ist erfunden. Hier geht es ausschließlich um „histoires vécues“ – am eigenen Leib Erlebtes und Erlittenes. Manche der in „Zwischen Hamburg und der Ferne“ enthaltenen Erzählungen kennen wir bereits aus verschiedenen Büchern, die der Autor im Laufe der Zeit über seine Reisen rund um den Globus geschrieben hat. Sein einzigartiges Fabuliertalent lässt uns seine Abenteuer hautnah miterleben. Dazu gehören u.a. „Fluchtort Guantánamo, „Heimaterde“ und „Die Brandung.“ In diesem Kontext hervorzuheben ist „Insel der Meuterer (Pitcairn), eine faszinierende Geschichte, die das Schicksal der Überlebenden der legendären „Bounty“ auf einer gottverlassenen Insel in der Südsee erzählt. Da dieses felsige Eiland offenbar auf den Seekarten der britischen Admiralty im 18. Jahrhundert nicht zu finden war, biss man sich im fernen London die Zähne aus nach dem Verbleib von Fletcher Christian und den übrigen Meuterern. Kaum zu glauben, aber es gibt auf Pitcairn immer noch Nachkommen dieses Aufrührers gegen die britische Krone.
Zurück zu den Wurzeln
Mit „Zwischen Hamburg und der Ferne“ überreicht uns Wolf Cropp einen bunten Blumenstrauß wunderbarer, den ganzen Erdball umspannender Erzählungen. Die literarische Reise endet, wo sie begann, in Hamburg. Hier begegnen wir der drallen „Seemannsbraut“ auf St. Pauli, erfahren manch Bizarres über die „Liebe in Zeiten von Corona“ und wohnen der Überführung der „Viermastbark Peking“ in ihren heimatlichen Hafen auf dem Grasbrook bei.
Fazit
Wer sehnt sich in dieser trüben kalten Jahreszeit nicht nach Sonne, Meer und Abenteuern in fernen Ländern? Empfehlung: Man greife zu „Zwischen Hamburg und der Ferne“ und genieße dieses fast 500 Seiten starke Buch in vollen Zügen. Viel Spaß bei der Lektüre.

(c) Verlag Expeditionen, Hamburg
„Zwischen Hamburg und der Ferne“ von Wolf Cropp ist im Verlag Expeditionen erschienen, umfasst 491 Seiten und kostet 20 Euro. ISBN 978-3-947911-68-4
Fotos: Wolf-Ulrich Cropp








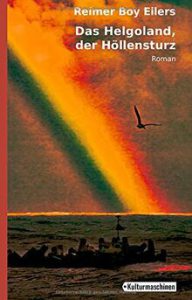
 Corona? Krieg in der Ukraine? Inflation? Die Kette an Stichwörtern, die uns mit großer Sorge erfüllen, wäre leicht zu verlängern. Am Sonnabend jedoch, den 2.Juli, war in den zauberhaften Anlagen von Planten un Blomen nichts von alledem zu spüren, schienen die Probleme dieser Zeit wie weggezaubert zu sein. Bei schönstem Wetter flanierten die Menschen durch die verschiedenen Gärten, vorbei an Wasserspielen und Blumenbeeten, machten Picknick mit Familien und Freunden, schleckten Eis oder … lauschten an einem von vier stimmungsvollen Plätze der Literatur! Ob im weiten Rund des Musikpavillons, inmitten der Blütenpracht des Rosengartens, im Schatten einer Baum-Oase oder am Ufer der Wasserarkaden; überall lasen – jeweils vier parallel – Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus ihren Werken Lyrik und Prosa.
Corona? Krieg in der Ukraine? Inflation? Die Kette an Stichwörtern, die uns mit großer Sorge erfüllen, wäre leicht zu verlängern. Am Sonnabend jedoch, den 2.Juli, war in den zauberhaften Anlagen von Planten un Blomen nichts von alledem zu spüren, schienen die Probleme dieser Zeit wie weggezaubert zu sein. Bei schönstem Wetter flanierten die Menschen durch die verschiedenen Gärten, vorbei an Wasserspielen und Blumenbeeten, machten Picknick mit Familien und Freunden, schleckten Eis oder … lauschten an einem von vier stimmungsvollen Plätze der Literatur! Ob im weiten Rund des Musikpavillons, inmitten der Blütenpracht des Rosengartens, im Schatten einer Baum-Oase oder am Ufer der Wasserarkaden; überall lasen – jeweils vier parallel – Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus ihren Werken Lyrik und Prosa.





 Gemeinsam mit dem Verband Deutscher Schriftsteller*innen Hamburg und gefördert von Neustart Kultur laden wir sehr herzlich zu unserem Lese-Fest ein. Seien Sie herzlich willkommen! Unternehmen Sie mit uns einen literarischen Spaziergang durch blühende Landschaften in „Planten un Blomen“.
Gemeinsam mit dem Verband Deutscher Schriftsteller*innen Hamburg und gefördert von Neustart Kultur laden wir sehr herzlich zu unserem Lese-Fest ein. Seien Sie herzlich willkommen! Unternehmen Sie mit uns einen literarischen Spaziergang durch blühende Landschaften in „Planten un Blomen“. Zur historischen Dystopie „Wenn der Führer wüsste…“ von Heiger Ostertag – Mal angenommen, Hitler hätte den Krieg gewonnen und wir lebten jetzt unter der Regierung seines Enkels Adolf II., der mit vierzig Jahren nach dem Tod seines Vaters Adolf Wolf die Herrschaft übernommen hätte. Den Leuten hat man die Legende erzählt, alle Juden hätten in Madagaskar ihren eigenen Staat bekommen. Die Denkmäler stehen noch, die nationalsozialistischen Werte auch – doch es beginnt zu rumoren. Nächstes Jahr wird eine Revolution angezettelt werden, in deren Folge die Regierung gestürzt werden soll. Finden Sie das schräg? Ist es auch. Aber so gut gemacht, dass es einem bei der Lektüre des Romans kalt den Rücken runterläuft. Nach dem viel beachteten Buch „Die Welle“ von Morton Rhue, das sich mit der Frage befasst, wie so ein Regime wie Hitlers möglich werden konnte, befasst sich „Wenn der Führer wüsste…“ mit einer Möglichkeit von Realität unter einer nationalsozialistischen Herrschaft und dem Aufbegehren der unterdrückten Bevölkerung.
Zur historischen Dystopie „Wenn der Führer wüsste…“ von Heiger Ostertag – Mal angenommen, Hitler hätte den Krieg gewonnen und wir lebten jetzt unter der Regierung seines Enkels Adolf II., der mit vierzig Jahren nach dem Tod seines Vaters Adolf Wolf die Herrschaft übernommen hätte. Den Leuten hat man die Legende erzählt, alle Juden hätten in Madagaskar ihren eigenen Staat bekommen. Die Denkmäler stehen noch, die nationalsozialistischen Werte auch – doch es beginnt zu rumoren. Nächstes Jahr wird eine Revolution angezettelt werden, in deren Folge die Regierung gestürzt werden soll. Finden Sie das schräg? Ist es auch. Aber so gut gemacht, dass es einem bei der Lektüre des Romans kalt den Rücken runterläuft. Nach dem viel beachteten Buch „Die Welle“ von Morton Rhue, das sich mit der Frage befasst, wie so ein Regime wie Hitlers möglich werden konnte, befasst sich „Wenn der Führer wüsste…“ mit einer Möglichkeit von Realität unter einer nationalsozialistischen Herrschaft und dem Aufbegehren der unterdrückten Bevölkerung. Dr. Heiger Ostertag (M.A.) gehörte der Luftwaffe an, in der er u. a. eine fliegerische Ausbildung absolvierte. In Freiburg studierte Ostertag Geschichte, Germanistik sowie Nordgermanische Philologie und promovierte mit einem historisch-germanistischen Thema zum Kaiserreich. Seit den 90er Jahren ist Heiger Ostertag als Autor und Historiker in Forschung, Bildung und Lehre sowie als Lektor im Verlagswesen tätig. Die Fachliteratur erschien bei Ullstein, Herder, Rombach und Mittler. Das belletristische Werk wird beim Südwestbuch-Verlag, Gmeiner und im Theiss Verlag/WBV verlegt. Auf der Basis exakter Recherchen und psychologischer Personenprofile entstanden in den 30 Jahren seines Schreibens kontextsituierte Geschichten und zahlreiche Romane von großer Dichte und Spannung. Unter Pseudonym sind vom Autor weitere brisante Politthriller erschienen. Einige Romane wurden zudem als Hörbuch vertont. Aktuell arbeitet der Schriftsteller am Abschlussband seiner Junker-von-Schack Reihe mit dem Arbeitstitel „Von Austerlitz nach Waterloo“.
Dr. Heiger Ostertag (M.A.) gehörte der Luftwaffe an, in der er u. a. eine fliegerische Ausbildung absolvierte. In Freiburg studierte Ostertag Geschichte, Germanistik sowie Nordgermanische Philologie und promovierte mit einem historisch-germanistischen Thema zum Kaiserreich. Seit den 90er Jahren ist Heiger Ostertag als Autor und Historiker in Forschung, Bildung und Lehre sowie als Lektor im Verlagswesen tätig. Die Fachliteratur erschien bei Ullstein, Herder, Rombach und Mittler. Das belletristische Werk wird beim Südwestbuch-Verlag, Gmeiner und im Theiss Verlag/WBV verlegt. Auf der Basis exakter Recherchen und psychologischer Personenprofile entstanden in den 30 Jahren seines Schreibens kontextsituierte Geschichten und zahlreiche Romane von großer Dichte und Spannung. Unter Pseudonym sind vom Autor weitere brisante Politthriller erschienen. Einige Romane wurden zudem als Hörbuch vertont. Aktuell arbeitet der Schriftsteller am Abschlussband seiner Junker-von-Schack Reihe mit dem Arbeitstitel „Von Austerlitz nach Waterloo“.

















 Das Buch von Reimer Boy Eilers: eigenwillig, ungewöhnlich, auf jeden Fall interessant. Ausgerechnet im Ramadan segelt der Held von Sansibars Nordwestküste aus zur sechs Kilometer vorgelagerten Insel Tumbatu. Tumbatu ist ein von Saumriffen umgebenes Eiland, verwunschen, dünn besiedelt, geheimnisvoll. Kein Wunder, dass dort, Erzählungen nach, irgendwo am Ufer ein heiliger Baum wachsen soll, vor dem einst eine Dhau, beladen mit Sklaven, wahrscheinlich aus dem Kongo, havarierte. Die Überfahrt mit einer einheimischen Crew und einem mysteriösen Geistheiler an Bord, ist zwar nur von kurzer Dauer, dennoch strapaziös. Der Held, ein weißer Tourist, leidet an diesem mörderisch heißen Tag an Wahnvorstellungen infolge quälenden Durstes. Wie Trugbilder erscheinen ihm Szenen von Sklaven, die auf eine Dhau gepfercht, eigentlich auf dem größten Sklavenmarkt Afrikas verkauft werden sollen. Das Riff macht sie zu Schiffbrüchigen, die verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Der Sklavenmarkt befindet sich auf Sansibar. Dort regiert der Sultan von Oman und Sansibar, ein unermesslich reicher Araber, der durch Sklaven, Sklavenhandel und Gewürznelken seinen Reichtum erwarb. Lieferant der Menschenfracht ist Tippu Tip, ein mächtiger Sklaven- und Elfenbeinhändler. Selbst mit dunkler Hautfarbe geboren, signalisiert er Vertrauen unter den Einheimischen Zentralafrikas. Lächelnd wickelt er seine Mitmenschen ein. Tritt der wahre, der grausame Händler hinter seiner Maske hervor, ist es zu spät. Er lässt Menschen aus dem Kongo jagen, treibt sie an die Küste, wo sie auf Schiffe verfrachtet, über den Sansibar-Kanal nach Stone Town auf den Sklavenmarkt geschleppt und verkauft werden. Sklavenschiffe kreuzten in jener Zeit überall auf den Weltmeeren. Geortet wurden sie an ihren Gestanksfahnen, die sie meilenweit hinter sich herzogen. Was es nun mit der Sklaven-Dhau, die da am Riff vor Tumbatu, in der Nähe des heiligen Baums zerschellte, auf sich hat, soll nicht verraten werden. Nur so viel: Der Autor führt uns auf eindringliche Weise die Schrecken der Sklaverei vor Augen. Nicht in Form aufrüttelnder Prosa, nein, mit einem epischen Gedicht, durch das man sich von wachsender Neugierde und Anteilnahme getrieben, durcharbeitet.
Das Buch von Reimer Boy Eilers: eigenwillig, ungewöhnlich, auf jeden Fall interessant. Ausgerechnet im Ramadan segelt der Held von Sansibars Nordwestküste aus zur sechs Kilometer vorgelagerten Insel Tumbatu. Tumbatu ist ein von Saumriffen umgebenes Eiland, verwunschen, dünn besiedelt, geheimnisvoll. Kein Wunder, dass dort, Erzählungen nach, irgendwo am Ufer ein heiliger Baum wachsen soll, vor dem einst eine Dhau, beladen mit Sklaven, wahrscheinlich aus dem Kongo, havarierte. Die Überfahrt mit einer einheimischen Crew und einem mysteriösen Geistheiler an Bord, ist zwar nur von kurzer Dauer, dennoch strapaziös. Der Held, ein weißer Tourist, leidet an diesem mörderisch heißen Tag an Wahnvorstellungen infolge quälenden Durstes. Wie Trugbilder erscheinen ihm Szenen von Sklaven, die auf eine Dhau gepfercht, eigentlich auf dem größten Sklavenmarkt Afrikas verkauft werden sollen. Das Riff macht sie zu Schiffbrüchigen, die verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Der Sklavenmarkt befindet sich auf Sansibar. Dort regiert der Sultan von Oman und Sansibar, ein unermesslich reicher Araber, der durch Sklaven, Sklavenhandel und Gewürznelken seinen Reichtum erwarb. Lieferant der Menschenfracht ist Tippu Tip, ein mächtiger Sklaven- und Elfenbeinhändler. Selbst mit dunkler Hautfarbe geboren, signalisiert er Vertrauen unter den Einheimischen Zentralafrikas. Lächelnd wickelt er seine Mitmenschen ein. Tritt der wahre, der grausame Händler hinter seiner Maske hervor, ist es zu spät. Er lässt Menschen aus dem Kongo jagen, treibt sie an die Küste, wo sie auf Schiffe verfrachtet, über den Sansibar-Kanal nach Stone Town auf den Sklavenmarkt geschleppt und verkauft werden. Sklavenschiffe kreuzten in jener Zeit überall auf den Weltmeeren. Geortet wurden sie an ihren Gestanksfahnen, die sie meilenweit hinter sich herzogen. Was es nun mit der Sklaven-Dhau, die da am Riff vor Tumbatu, in der Nähe des heiligen Baums zerschellte, auf sich hat, soll nicht verraten werden. Nur so viel: Der Autor führt uns auf eindringliche Weise die Schrecken der Sklaverei vor Augen. Nicht in Form aufrüttelnder Prosa, nein, mit einem epischen Gedicht, durch das man sich von wachsender Neugierde und Anteilnahme getrieben, durcharbeitet.