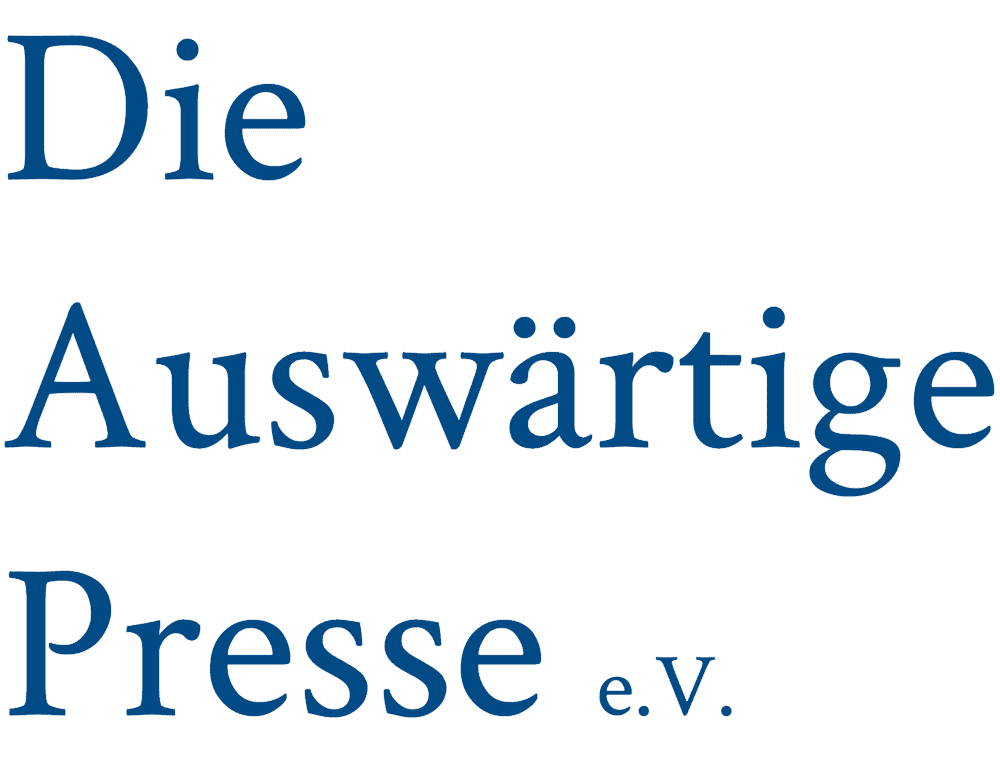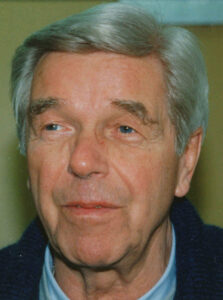Am 19. September 1909 erzielte der spätere Konstrukteur des VW Käfer Ferdinand Porsche nicht nur am Steuer eines Rennwagens einen Klassensieg, sondern wurde auch das erste und letzte Mal Vater eines Sohnes. Ferdinand Anton Ernst waren die Vornamen, aber sein Kindermädchen nannte ihn Ferry, und unter diesem Namen ging er in die Automobilgeschichte ein.
Nur wenige andere Kinder sind derart systematisch für den Automobilbau ausgebildet worden. Durch eine Sondergenehmigung erhielt der gebürtige Wiener bereits mit 14 Jahren einen Motorrad- und mit 16 Jahren einen Autoführerschein, um alle Prototypen fahren zu können, die der Vater von der Arbeit mit nach Hause brachte. Nach der Mittleren Reife machte er ein einjähriges Praktikum beim Automobilzulieferer Bosch und erhielt dann ein Jahr Privatunterricht in Automobiltechnik. Nachdem der Vater sich in Stuttgart selbstständig gemacht hatte, arbeitete Ferry ab 1931 in dessen Konstruktionsbüro. 1940 wurde er stellvertretender Betriebsleiter.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Vater und Sohn von den Kriegssiegern verhaftet. Der Sohn kam bald wieder frei, aber beim Vater dauerte es bis zum August 1947. Wenige Jahre, nachdem der Vater endlich entlassen worden war, starb er im Januar 1951.
Die Nachkriegsgeschichte des von Ferdinand Porsche gegründeten Unternehmens ist deshalb stark von Ferry Porsche geprägt. Dieser schloss finanziell sehr günstige Verträge mit dem ab 1948 amtierenden neuen Generaldirektor des Volkswagenwerks, Heinrich Nordhoff, die dem Familienunternehmen Beinfreiheit und die Erschließung neuer Geschäftsfelder ermöglichten. Unter Ferry Porsche kam zur Konstruktion die Produktion von Autos. Unter ihm begnügte sich das Unternehmen nicht mit der Modellpflege des VW Käfer einschließlich der späteren Entwicklung eines Nachfolgers, vielmehr entwickelte der Sohn auf der Basis der Konstruktion seines Vaters einen Sportwagen und baute diesen auch noch. Die Rede ist vom Porsche 356, der ab 1948 17 Jahre lang gebaut wurde. 1964 kam der kantigere, modernere, größere und leistungsstärkere Porsche 911 hinzu, der mit wesentlichen Änderungen bis heute gebaut wird.
1972 zog sich Ferry Porsche aus der Geschäftsführung zurück, und das Unternehmen wurde in eine Aktiengesellschaft mit ihm als Aufsichtsratsvorsitzenden umgewandelt. Vor einem Vierteljahrhundert, am 27. März 1998, starb Ferry Porsche in Zell am See.
(Dieser Artikel erschien zuerst in der Preußischen Allgemeinen Zeitung.)